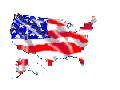Die Indianer Nordamerikas
|
|
|
Fällt der Begriff "Indianer", taucht vor dem geistigen Auge vieler Menschen die "edle Rothaut" mit Adlerfedern im Haar auf, die auf ihrem Mustang endlose Prärien durchstreift. Dieses im 18. Jh. entstandene Klischee ist ebenso romantisch wie falsch und wird den nordamerikanischen Ureinwohnern auf keinen Fall gerecht. Schon der Name "Indianer" ist irreführend, beruht er doch auf dem Irrtum des Kolumbus', in Indien gelandet zu sein. Die eigentlichen "Entdecker" Nordamerikas, die indianischen Völker, die in über hundert verschiedenen Stammesstrukturen, noch mehr verschiedenen Sprachen und Kulturformen in einem riesigen Siedlungsgebiet lebten, nannten sich in ihrer Gesamtheit selbst "Menschenwesen", "Menschen" oder "Verbündete" - außer dem Wort "Mensch" wurde keine weitere Gemeinsamkeit gebraucht. Auch die im 18. und 19. Jh. aufgekommenen Bezeichnungen wie Sioux, Cheyenne oder Comanche sind entweder von Weißen geprägte oder von Nachbarstämmen Bezeichnungen, die dem im Eigennamen des Stammes enthaltenen Selbstverständnis nicht gerecht wurden. Von der weißen Warte betrachtet blieben z.B. die Sioux, die man ohne zu differenzieren als Indianer bezeichnen und, traditionellen Vorurteilen folgend, in ihrem Menschsein anzweifeln konnte, denn es war einfacher sie zu bekriegen, zu vertreiben, auszurotten und zu betrügen, wenn man ihnen menschliche Attribute absprach. Dieses Vorgehen gegen die Völker Nordamerikas begann mir der Kolonisierung durch die Europäer, zog eine blutige Spur durch die Jahrhunderte, und erst in unserer Zeit gibt es Versuche, dem Identitätsanspruch dieser Menschen gerecht zu werden.

Als sich herausstellte, dass die Eingeborenen keine Ostinder waren, begannen die ersten Spekulationen über die Herkunft der Menschen Nordamerikas. Da sie in der Bibel nicht vorkamen, wurde ihr Menschsein sogar eine Zeitlang geleugnet. Erst 1512 erklärte Papst Julius II. öffentlich, dass die "Indianer" der Neuen Welt echte Abkömmlinge Adams und Evas seien und somit aus dem Garten Eden gekommen sein müssten. Entsprechend bezeichne eine der ältesten Theorien sie als die Nachkommen der "Zehn verlorenen Stämme Israels".
Der Jesuit José de Acosta kam im Jahre 1590, 150 Jahre vor Entdeckung der Beringstrasse, der Antwort auf die Frage nach der Herkunft der amerikanischen Urbevölkerung erstaunlich nahe: "Es ist nicht wahrscheinlich, dass es eine zweite Arche Noah gegeben hat, mit der die Menschen nach Ostindien geschafft worden sind, oder gar einen Engel, der die ersten Menschen in diese neue Welt getragen hat. [...] Ich komme also zu dem Schluss, dass die ersten Menschen in diese neue Welt vielmehr auf Grund von Schiffbruch und schlechtem stürmischem Wetter nach Amerika gekommen sind." Da ein Schiffbruch jedoch das Vorhandensein von Tieren in der Neuen Welt nicht erklärte, schloss Acosta, dass es im Norden ein Stück Amerika geben müsse, "das nicht gänzlich getrennt und abgeschnitten war, über das die Tiere gezogen sind."
Der Engländer Edward Brerewood ging im 17. Jh. davon aus, dass die Indianer "wenig Interesse für die Artes, die Wissenschaft oder Kultur Europas, ebenso wenig wie für diejenigen Chinas und des zivilisierten Asiens" zeigten, und der Farbe wegen konnten sie keine Nachkommen von Afrikanern sein. Übrig blieben nur noch die "Tataren", mit dem die Bewohner Nord- und Zentralasiens bezeichnet wurden. Bei ihnen glaubte Brerewood kulturelle Parallelen zu Amerika gefunden zu haben. Er vermutete eine Landverbindung und verlegte sie "in jenen nordöstlichen Teil Asiens, wo die Tataren wohnen". Zwar irrte er, als er die indianische mit der tatarischen Kultur gleichsetzte, doch erwiesen sich Teile seiner Schlussfolgerungen als richtig. 200 Jahre später wies Alexander von Humboldt auf eine "auffallende Ähnlichkeit zwischen Amerikanern und der mongolischen Rasse" hin. Die moderne Wissenschaft hat seine Ansicht bestätigt: Heute steht eine enge genetische Verwandtschaft zwischen Indianern und den Völkern Nordostasiens fest.
Die "Entdeckung" Amerikas
Ob die Phönizier tatsächlich Handelsbasen in den heutigen USA hatten, ob die verlorenen Stämme Israels, bretonische Fischer oder irische Mönche Amerika an der Entdeckung beteiligt waren, gehört ins Reich der Spekulationen. Historisch belegt ist die Landung des Wikingers Leif Eriksson um 1000 n.Chr. in Neufundland, dem der erste Siedlungsversuch um 1005 durch die Wikingergruppe unter Thorfinn Karlsefni folgte, die sich in Vinland (höchstwahrscheinlich Neufundland) niederlassen wollten. Sie berichteten als erste über die amerikanischen Ureinwohner, die sie "Skrälinger" nannten, vermutlich Eskimos. Das anfänglich zurückhaltend freundliche Verhältnis beider Gruppen geriet zum Streit, dann zum Kampf und endete mit der Aufgabe des Siedlungsversuchs der Wikinger im heute kanadischen L'Anse aux Meadows. Für knapp 500 Jahre verschwand der amerikanische Kontinent wieder aus dem Bewusstsein der Alten Welt. Am 12. Oktober 1492 "entdeckte" Christoph Columbus Amerika für die spanische Krone. Von Mittelamerika her erkundeten die Spanier das neue Land auch nach Norden hin. Der zweijährigen Reise von Cabeza de Vaca durch den südlichen Teil Nordamerikas folgte die militärische Besiedlung durch die Spanier, die im Zeichen des Kreuzes den Ureinwohnern das Christentum und ihrem Herrscherhaus vor allem Gold und Sklaven bringen wollten.

Andere Mächte zogen nach: Von Norden in Richtung Süden kolonisierten Engländer an der Ostküste entlang den neuen Kontinent, die Franzosen besetzen Louisiana und Teile des Mississippi-Tals. Die indianischen Gesellschaften gerieten aufgrund des Drucks in Bewegung und begannen, sich umzustrukturieren.
Das Schicksal der Ostküstenindianer
Zwischen 1559 und 1570 gründeten die Senaca, Onondaga, Cayuga, Mohawk und Oneida die Fünf-Nationen-Konföderation der Irokesen, einen Verbund von Bauern- und Jägerstämmen, der eine solch hohe Stufe gesellschaftlichen und politischen Fortschritts erreichte, dass Teile seiner "demokratischen" Ideen Einfluss auf die US-amerikanische Verfassung nahmen. Mit Anlandung von Siedlern auf dem Gebiet der zwanzig Algonkinstämme umfassenden Powhatan-Konföderation (heute Virginia) und der Gründung von Jamestown im Jahr 1607 fassten die Briten Fuß in Nordamerika. 1620 trafen die "Pilgrim Fathers" auf dem Territorium des Algonkin-Doppelstammes der Wampanoags und Pokanokets bei Cape Cod im heutigen Bundesstaat Massachusetts ein. Ihre Siedlung konnte während der ersten beiden Jahre nur durch massive Unterstützung seitens der Indianer einer Hungerkatastrophe entgehen. Metacomet, Sohn des Wampanugahäuptlings, sah schon damals keine andere Rettung für sein Volk, als die Weißen zurückzudrängen. Er verbündete sich mit den Narragansett von Rhode Island und anderen Stämmen und begann im Jahr 1675 mit dem sog. König-Phillip-Krieg, der zwei Jahre dauerte und zur Zerstörung von zwölf englischen Siedlungen führte. Die Kolonisten schlugen erbarmungslos zurück; auch Metacomet wurde getötet, seine Frau und sein Sohn in die Sklaverei verkauft. Der Ottawa-Häuptling Pontiac erhob sich von 1754 an gegen die Briten. Ihm gelang 1763 die Vereinigung mehrerer Stämme; diese sog. "Revolution des Roten Mannes" war der größte und erfolgreichste Krieg des 18. Jh.s aus Sicht der Indianer. Der amerikanische Revolutionskrieg brachte das Ende der Irokesenkonföderation, die seit 1722 dank Hiawathas Einflussnahme um die Tuscarora erweitert worden war. Die Stämme wurden durch Verhandlungstaktik und leere Versprechungen beider Seiten aus ihrem Verband herausgebrochen, aufeinandergehetzt und bedeutungslos gemacht. Zwar besiegte 1791 der Miamihäuptling Little turtle den US-General Arthur Saint Clair im Ohio-Tal, doch von 1830 an verstärkte der Einwanderungszustrom den Siedlungsdruck nach Westen. Es begann die Politik der Umsiedlung durch den Indian Removal Act: In den 1830er und 40er Jahren wurden die "Fünf Zivilisierten Nationen" (Cherokee, Choctaw, Creek, Chickasaw, Seminole) ins ferne Oklahoma vertrieben ("Trail of Tears"); die Seminolen widersetzten sich in einem Guerillakrieg in den Sümpfen Floridas bis 1842.
Die Indianer der Prärien und Plains
Die Kolonisation und Besiedlung durch die Europäer führte auch im Herzen des Kontinents zu dramatischen Veränderungen. Bis etwa zur Mitte des 17. Jh.s waren die Prärien und Plains des mittleren Westens und Südwestens nur an den Rändern sowie an Stellen mit Wasservorkommen von einfach arbeitenden Ackerbauern besiedelt: am südlichen Rand der Grasebene kleine Gruppen von Apachen, Paducahs genannt, im Nordwesten, im heutigen Oregon, Cayuse, Comanchen in Wyoming, Cheyenne, Arapohoes und Absaroka im Gebiet der Großen Seen. Schwarzfuß (Piegan) lebten an der kanadischen Grenze, und Siuoan sprechende Stämme jagten im Waldland des Nordwestens. Für all diese Stämme blieben die Plains aufgrund ihrer Weite verschlossen. Gleichwohl bargen die Grasmeere einen unermesslichen Nahrungsreichtum im Form einer Millionen zählenden Büffelpopulation, die nur in bescheidenem Umfang bejagt wurde. Zwei "technische Neuerungen" veränderten dieses Gefüge nachhaltig.
Um 1620 gelangten über die Hudsonbay Company Feuerwaffen in den Besitz der Stämme um das Seengebiet. Was als Mittel zur Ertragssteigerung bei der Pelztierjagd gedacht war, wurde von den Ojibway zum Angriff auf die kleineren Nachbarstämme benutzt. Diese waren gezwungen, immer weiter westlich abzuwandern, wenn sie dem Druck der besser Bewaffneten ausweichen wollten.
Im spanisch besetzten Süden war es den Indianern bis zur 1680 beginnenden Pueblo-Revolution verboten, Pferde zu besitzen. Nach der Vertreibung der Spanier vermehrten sich die nun in Freiheit lebenden Pferde, wurden zu Tauschhandelsobjekten und verteilten sich zusätzlich über die weit verbreiteten Diebstähle. Manche Pferdeherden wanderten durch die Plains; Pferde aus kalifornischen Niederlassungen zogen an der Küste entlang nach Oregon. Als besonders fähige Züchter taten sich die Cayuse hervor, die den berühmten Appaloosee züchteten. Von diesen Stämmen wurde das Pferd weiter nach Osten verbreitet. Die ersten Reiter am Rand der Plains waren die Paducahs. Sie benutzten ihre neue Macht, um die benachbarten Pawnee und andere Caddastämme zu plündern. Mitte des 18. Jh.s erreichte das Pferd die uto-aztekischen Comanchen. Sie verließen ihre Heimat Wyoming, fielen in die Ebene ein und vertrieben die Paducahs. Die Cheyenne und Arapahoe zogen westwärts, ebenso dir Crow (Absarokee) und die mit ihnen verwandten Mandan. Um 1785 hatten sich die Siouan sprechenden Lakotah vollkommen auf das Pferd eingestellt. Die Kiowa zogen etwas später aus Montana in das Gebiet zwischen Texas und Oklahoma und überfielen von dort aus, zusammen mit den Comanchen, spanische und peoblo-indianische Siedlungen. Die Paducahs erreichten den Südwesten und schlossen sich ihren Apachenverwandten an.
Außer den Mandan und den Pawnee gaben alle Stämme den bisherigen Ackerbau auf und entwickelten eine Kulturstufe, die sich, gestützt auf Pferd und Büffel, von der Jagd ernährte. Büffel waren die Lebensgrundlage der Präriestämme geworden. Sie gaben Nahrung, Kleidung und Wohnung und zwangen den Stämmen ihren Lebensrhythmus auf. Um die Jagdgebiete entwickelten sich Kämpfe, die sehr oft hohen Blutzoll forderten. zum Schutz der wandernden Sippen und Stämme entstanden Sozialstrukturen, die sich in Kriegerschaften, Riten und komplizierten Beziehungen untereinander ausdrückten. Der Überlebenskampf stand immer in Abhängigkeit von Pferd und Büffel: Geringste Veränderungen, z.B. das Ausbleiben der Herden nach einem strengen Winter, konnte zu Hungerkatastrophen führen; der Verlust eines großen Teils der Männer durch Tod im Kampf konnte eine Sippe ins Elend stürzen. Auf der anderen Seite bedeuteten Pferd und Büffel gewaltigen Reichtum und Anerkennung für den Stamm, die Sippe oder den Krieger, die damit großzügig umgingen: Verschwendung war an der Tagesordnung.
Der Glaube, dass diese Präriekultur im Einklang mit der Natur lebte, ist irrig. Die z.T. riesigen Pferdeherden der Indianer verwüsteten Weiden und Landschaften auf lange Jahre hinaus. Die Büffelherden wurden teilweise massenhaft vernichtet. Auch ohne den Einfluss der Weißen wäre diese Krieger- und Jägerkultur wohl an sich selbst zugrundegegangen, zumal fast jedes ihrer wichtigen Elemente - seien es Pferd, Feuerwaffen oder Metall - aus der Welt des weißen Mannes kam. Ebenso war die Hochstilisierung des Kampfes zum Sport oder Spiel ein weiteres Indiz für die geringe Überlebenschance dieser Art von Zivilisation. Die Lebensgrundlage vieler Familien und Sippen wurden durch Krieg zerstört; die Kopfzahlen waren zu gering und das zahlenmäßige Verhältnis männlicher und weiblicher Stammesangehöriger zu ungleich, als dass die Existenz der Präriekultur auf Dauer gewährleistet gewesen wäre.
In ihrer Vielfalt und Farbigkeit, ebenso in ihrer Freiheit war diese Kultur wohl dennoch einzigartig auf der Welt. Sechs verschiedene Sprachfamilien mit insgesamt 22 Sprachen konnten sich in Friedenszeiten durch eine eigens entwickelte Zeichensprache auch über komplizierte Dinge unterhalten und austauschen. Mit der Zeit glichen sich die Präriestämme in ihrer Kleidung, ihren Werkzeugen und in ihren Behausungen immer mehr. Bei vielen Stämmen entstanden ähnliche Organisationsformen. Der Stammeshäuptling konnte gewählt sein oder seinen Titel geerbt haben, trotzdem konnte er bei fast allen Stämmen nur beraten und nicht befehlen. Überall gab es Rats- und Kontrollorganisationen, die ein friedliches Stammesleben garantieren und Streitigkeiten schlichten sollten. Die Meinung der Gesamtheit des Stammes war immer entscheidend. nur in Zeiten der Hauptjagd oder bei Kriegsgefahr unterwarf man sich der eisernen Disziplin einer strengen Lagerpolizei.
Der Feldzug gegen die Indianer
Schon 1763 bestätigte ein britischer Erlass das Recht der Indianer auf ihre angestammte Heimat. Als Landerwerbsgrenze für Siedler galten die Appalachen. Auch die USA hielten sich nach ihrer Gründung an diese politische Leitlinie. Zu Beginn des 19. Jh.s bestätigte der Jurist und Bundesrichter John Marshall ausdrücklich den Nationalstatus der Indianervölker und deren natürliche Rechte auf den Besitz der Länder, die sie bewohnten: "Den Indianern soll mit höchstmöglicher Redlichkeit gegenüber gehandelt werden: Land und Eigentum sollen ihnen niemals ohne ihr Einverständnis genommen werden; und in ihrem Besitz, ihren Rechten und Freiheiten, sollen sie niemals beeinträchtigt oder eingeschränkt werden, außer in gesetzlich gerechtfertigten, vom Kongress autorisierten Kriegen." Auf dieser Grundlage schlossen die USA Verträge mit den Ureinwohnern ab, von denen beinahe alle im Laufe der Zeit gebrochen wurden.

Gemäß dem Indian Removal Act wurde ab 1837 und in den folgenden Jahrzehnten fast die gesamte indianische Bevölkerung der östlichen USA zum Teil gewaltsam in das "Indian Territory" auf dem Gebiet des heutigen Staates Oklahoma verbracht. Dieses Territorium war dem Kriegsministerium unterstellt, seine Fläche wurde wiederholt verkleinert, 1889 z.T. den Weißen geöffnet und 1907 dem Staat Oklahoma zugeordnet.
Im Südwesten hatten die Indianer seit 1680 die Spanier aufgehalten. Seit 1760 gingen Comanchen- und Apachenstämme sogar zum Angriff über, der, als Spanien 1824 Mexiko aufgeben musste, so mörderisch war, dass die meisten Weißen aufgrund immenser Verluste Neu-Mexiko und Neu-Spanien verließen. Nach der Gründung des Staates Texas sah man dort die Ausrottung oder Vertreibung der Indianer als beste Lösung an. Es begann ein rücksichtsloser Feldzug mit dem Ergebnis, dass bis 1855 alle Indianerstämme der Region aufgaben: 1856 wurde Texas als "indianerfrei" erklärt. Nur die Comanchen sicherten ihre nackte Existenz durch zahllose Rückzugsgefechte bis in die äußersten Wüstenecken des Texas-Panhandles. Auch der Widerstand der Apache-Guerilla in Neu-Mexiko und Arizona wurde erst 1886 gebrochen.
Die Indianerpolitik der USA im 20. Jahrhundert
Nach der Auflösung des indianischen Kollektivbesitzes durch den General Alloment Act wurden 1908 weitere Teile der Reservationen durch Regierungserlass den Weißen zugänglich gemacht. Erst im Juni 1924 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, das alle in den USA geborenen Indianer zu Bürgern mit gleichen Rechten wie Weiße erklärte. Im "Indian Reorganisation Act" von 1934 wurde den Stämmen das Recht zur Selbstverwaltung gegeben und die Rückgabe aller Stammesgebiete in Regierungsbesitz beschlossen. Dieses Land wird aber weiterhin vom BIA verwaltet. Seit 1946 versucht die vom BIA unabhängige Indian Claims Commission, indianische Ansprüche aus nicht eingehaltenen Verträgen geltend zu machen. bisher sind mehr als 1000 Ansprüche registriert; einige konnten gerichtlich durchgesetzt werden, viele stehen noch aus, darunter eine Millionenforderung der Sioux für die vertraglich zugesicherten Black Hills. Mit der 1967 gegründeten United Tribes Corporation (UTC) versuchen früher verfeindete Stämme, in den Reservaten von North Dakota Industrie anzusiedeln. 1969 entstand im Zusammenwirken von UTC und BIA ein Familien-Trainingszentrum, dessen Ziel der Anschluss an die Welt der Weißen ist.

Diesem vermeintlichen Fortschritt stehen Fakten gegenüber, die als fortwährende Diskriminierung der Indianervölker und fortschreitende Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen gesehen werden müssen. Dabei ist der Schaden, den die 1951 ausgesprochene Aufhebung des Alkoholverbots für Reservationen anrichtet, nicht zu unterschätzen. Wie im 19. Jh., müssen sich die Indianer mit der weiteren Landnahme und Zerstörung ihrer Landschaften auseinandersetzen, denn auch die Reservationen sind reich an Bodenschätzen. So wird auf dem Gebiet der Inupiah-Inuit das größte Blei-Zinkvorkommen der erde (85 Mio. t) abgebaut, die vereinbarte Entschädigung durch Arbeits- und Ausbildungsverträge aber kaum eingehalten. Innerhalb des Territoriums der La Courte Orreilles Chippewa wird im großen Stil Kupfererz abgebaut. Der Versuch der Chippewa, die Vergrößerung des Abbaugebietes vor den Gerichten Wisconsins zu stoppen, scheiterte an den zu hohen Prozesskosten. 70 Prozent des Weltnaturvorkommens liegen auf dem Gebiet indianischer Völker. Gegen den Abbau wehren sich die Lakota und Navajo.

Heute bekennen sich wieder ca. 2 Mio. US-Amerikaner zu einer indianischen Abstammung. Nur ein Fünftel von ihnen lebt in Reservaten, deren größtes das Navajo-Reservat in New Mexico, Arizona und Utah mit 143 000 Einwohnern (nicht nur Navajo) ist; deutlich weniger Menschen - 11 000 Sioux - leben im zweitgrößten Reservat, der Pine Ridge Reservation bei Wounded Knee. Oklahoma verzeichnet mit 252 000 Indianern den größten indianischen Anteil, gefolgt von Kalifornien (242 000), Arizona (204 000), New Mexico (134 000) und Alaska (86 000). Die größten Stämme sind die Cherokee (308 000), die Navajo (219 000), die Chippewa (104 000) und die Sioux (103 000). Ein Drittel der Indianer aber lebt unter der Armutsgrenze, wobei die Situation in den Reservaten besonders schlimm ist.