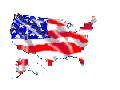Staat und Gesellschaft
|
|
Die Flagge der USA, das Sternenbanner oder volkstümlich 'Stars and Stripes', zeigt sieben rote und sechs weiße Streifen, die die dreizehn Urstaaten der Union symbolisieren, sowie in der linken oberen Ecke ein blaues Feld mit fünfzig weißen Sternen, die für die heutigen fünfzig Staaten stehen. Die Bundesflagge entstand im Unabhängigkeitskrieg (1777) und trug ursprünglich dreizehn im Kreis stehende Sterne als Symbol der dreizehn Urstaaten. Das Staatswappen der USA ist der blau-weiß-rote Brustschild, den das Wappentier, der Weißkopfseeadler ('bald eagle'), trägt. Er hält ein Band mit dem Motto "Ex pluribus unum" ("Aus vielen eines") im Schnabel. Obwohl imperiales Symbol, wählten die revolutionären Amerikaner dennoch den Adler zum Wappentier.

Der Text der erst 1931 offiziell eingeführten Nationalhymne "The Star-Spangled Banner" ("Das Sternenbanner") wurde von Francis Scott Key bereits 1814 gedichtet. Er beschreibt darin, wie er am Morgen des 14. September 1814 die Flagge über Fort Henry bei Baltimore auch nach 25stündiger Beschießung durch die Briten noch immer wehen sieht.
Die Vereinigten Staaten von Amerika umfassen 50 Bundesstaaten, den Bundesdistrikt District of Columbia um die Hauptstadt Washington sowie vier assoziierte Sondergebiete, die nicht den Status eines Bundesstaates besitzen: Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Guam und American Samoa.
Die amerikanische Verfassung von 1787 wird von der für die damalige Zeit revolutionären Idee getragen, dass eine rechtsstaatliche Regierung und nicht persönliche Willkür ('Government of laws and not of men') die bestmögliche demokratische Staatsführung garantiert. Die Form der amerikanischen Demokratie ist daher vor allem von der Gewaltenteilung ('separation of powers') sowie einem System von Kontrollen und Gegengewichten ('Checks and balances') geprägt. Um der Gefahr jeglicher Form absoluter Macht zu begegnen, hat in den USA jeder der drei Zweige der Staatsgewalt - Exekutive (der Präsident und seine Minister), Legislative (Kongress), und Judikative (richterliche Gewalt, in der höchsten Instanz durch den 'Supreme Court' ausgeübt) - bestimmte Kontrollfunktionen gegenüber den jeweils anderen beiden. Der Supreme Court beispielsweise entscheidet über die Rechtsmäßigkeit der im Kongress formulierten Gesetze, der Präsident besitzt ein Vetorecht gegen Gesetze, die der Kongress verabschiedet, der Senat als Teil des Kongresses wiederum kann Amtsernennungen durch den Präsidenten ablehnen. Besonders Kongress und Präsident sind in der politischen Realität in gegenseitiger Abhängigkeit zur Zusammenarbeit gezwungen. In dem von Spannungen geprägten Verhältnis der 'antagonistischen Partnerschaft' liegt der Kern des politischen Systems der USA, das sich in dieser Hinsicht stark vom parlamentarischen System unterscheidet.
Als die 'Founding Fathers', die Schöpfer der Verfassung, im Mai 1787 in Philadelphia zusammentraten, hatte sich der erste Versuch, eine staatliche Organisation in den 'Articles of Confederation' von 1777 zu formulieren, bereits als unzureichend erwiesen. Denn aus Furcht vor einer Zentralgewalt, die aus der Kolonialherrschaft Großbritanniens herrührte, hatten die dreizehn Urstaaten der neuen Zentralinstanz kaum Befugnisse, nicht einmal Steuerhoheit, eingeräumt. Die neue Verfassung von 1787 stärkte nun die Bundesautorität, dennoch gelten deren Rechte weiterhin als nur abgeleitet ('derived') von den originären Rechten der Bundesstaaten. Deren primäre Zuständigkeit für bestimmte Angelegenheiten erreicht heutzutage nicht mehr dasselbe Maß wie zu den Anfängen der Republik; der Katalog ihrer Vorrechte ist allerdings noch groß, vor allem weil sie grundsätzlich alles bestimmen können, was nicht ausdrücklich der Zuständigkeit des Bundes überlassen wird ('states rights'). Wer durch die Vereinigten Staaten reist, wird mancherorts mit der Selbständigkeit der einzelnen Bundesstaaten durch markante Beispiele aus dem Alltagsleben konfrontiert: So sind etwa die Bestimmungen über den Ausschank und Verkauf von alkoholischen Getränken oder die Einfuhr von bestimmten Lebensmitteln, die Regelung der Sommerzeit oder die Auslegung des Eherechts sehr unterschiedlich. Auch fallen die Polizeiordnung, das Wahlrecht und die Schulgesetzgebung in den Zuständigkeitsbereich der Einzelstaaten.
Da die Verfassung von 1787 keinen Grundrechtekatalog enthielt, wurden 1791 die ersten zehn Novellen ('amendments') als sog. 'Bill of Rights' angenommen. Obwohl sie nicht zur eigentlichen Verfassung gehört, war die Verabschiedung der 'Bill of Rights' für eine bedeutende Anzahl der Abgeordneten Bedingung für die Ratifikation des gesamten Dokuments. Die ersten beiden Novellen garantieren allgemeine Grundrechte: Religions-, Rede-, Presse- und Versammlungsfreiheit sowie das Recht, Waffen zu tragen - was bei den heutigen Kriminalitätszahlen in den USA problematische Auswirkungen hat. Jedes restriktive Waffengesetz jedoch wird von den davon betroffenen Interessengruppen - allen voran die Waffenhersteller und die National Rifle Asociation (NRA) - als Versuch dargestellt, ein Grundrecht anzutasten, und hat deshalb meist wenig Erfolgschancen. Die dritte und vierte Novelle gilt der Sicherheit des Privateigentums, während die fünfte bis achte Novelle sich auf die Sicherung rechtsstaatlicher Prozeduren bei der Verfolgung von Rechtsvergehen bezieht. Die neunte garantiert die Rechte des Volkes, die in der Verfassung nicht erwähnt wurden, und die zehnte die Rechte der Bundesstaaten. Weitere wichtige Novellen betreffen die Abschaffung der Sklaverei (XII, 1865), das Verbot, Grund- oder Wahlrechte aufgrund der Rassenzugehörigkeit einzuschränken (XIV, 1868; XV, 1870) und die Einführung des Wahlrechts für Frauen (XIX, 1920). Der hauptsächlich von der feministischen Bewegung getragene Versuch in den achtziger Jahren, das Gleichheitsprinzip für die Geschlechter in der Verfassung zu verankern ('Equal Rights Amendment'), scheiterte allerdings daran, dass nicht genügend Bundesstaaten das Gesetzesvorhaben ratifizierten.
Der Präsident der Vereinigten Staaten wird alle vier Jahre, jeweils am Dienstag nach dem ersten Montag im November eines Schaltjahres durch das Volk indirekt gewählt. Die vierjährige Amtsperiode beginnt und endet am 20. Januar des auf das Wahljahr folgenden Jahres. Gemäß der 22. Verfassungsnovelle von 1951 kann ein Präsident nur noch einmal wiedergewählt werden (Franklin D. Roosevelt hatte es auf vier Amtsperioden hintereinander gebracht); bei seinem vorzeitigen Tod bzw. Abtritt folgt ihm automatisch der Vizepräsident bis zum Ende der laufenden Amtszeit nach.
Der Präsident wird in einem zweistufigen Verfahren gewählt. Die meisten Staaten veranstalten im Frühjahr des Wahljahres Vorwahlen ('primaries'), in denen entschieden wird, welche Kandidaten der beiden großen Parteien in den Hauptwahlen auf Parteiebene gegeneinander antreten. Je nach Stimmenverteilung in den einzelnen Staaten werden Delegierte zu den Nationalkongressen der Parteien entsandt, die letztendlich die Kandidaten aufstellen. Primaries sind in der Regel für alle Wahlberechtigten offen; man kann allerdings nur für eine Partei teilnehmen. In einigen Staaten wird die Funktion der Primaries von Parteiversammlungen ('caucuses') erfüllt, in denen die Delegierten von Wahlberechtigten und Parteimitgliedern bestimmt werden. Auch Bewerber um andere Ämter - wie Gouverneure oder Kongressabgeordnete - werden durch Primaries bestimmt. Ein Präsidentschaftskandidat muss nicht von einer Partei aufgestellt werden; unabhängige Kandidaten können an den Wahlen teilnehmen, doch fehlen ihnen zumeist Finanzkraft und Organisation für eine ernsthafte Bewerbung. In der Hauptwahlphase wählen die Bürger formal das Wahlmännergremium ('Electoral College'), was de facto allerdings auf die Direktwahl des Präsidenten hinausläuft. Die Zahl der Wahlmänner (und selbstverständlich auch -frauen) eines Staates errechnet sich nach dessen Vertretung im Kongress als Summe seiner Abgeordneten im Repräsentantenhaus plus zwei für seine Senatoren. Der Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen in einem Staat gewinnt, gewinnt damit alle Wahlmänner des jeweiligen Staates, und so kann es zu einem Erdrutschsieg die Wahlmänner betreffend kommen ('landslide'), auch wenn die tatsächlichen Wählerstimmen für die einzelnen Kandidaten nicht so sehr auseinander klaffen.
Stellung und Einfluss des Präsidenten sind zwar mächtig, doch wegen der schon erwähnten Abhängigkeit vom Kongress ist es irreführend, das US-amerikanische System als ein 'Präsidialsystem' zu bezeichnen, da der Begriff die Wechselbeziehung zwischen Präsident und Kongress zu sehr vernachlässigt. Der Präsident ernennt zwar allein alle Minister seines Kabinetts, doch der Senat kann sie ablehnen und nimmt dieses Recht auch wahr. Auch hat der Präsident kein Recht auf Gesetzesinitiative und darf nur - abgesehen von programmatischen "Bericht zur Lage der Nation" - auf Einladung vor dem Kongress sprechen. Andererseits besitzt er durch den Umstand, dass die Abgeordneten nicht an Parteiweisungen gebunden sind, große Möglichkeiten zur Einflussnahme auf den Einzelnen, was vor wichtigen Entscheidungen heutzutage oft durch ausgiebige Telefonate des Präsidenten mit unsicheren Abgeordneten geschieht. Neben den heute sechzehn Ministern ('Secretaries') schart sich eine erkleckliche Zahl von Gremium und Beratern um den Präsidenten, zu deren wichtigsten und einflussreichsten der Nationale Sicherheitsrat (National Security Council) und der Stab des Weißen Hauses (White House Staff) gehört.
Der Vizepräsident ist formal ohne bestimmende Funktion in der Regierung. Auch seine Position als Vorsitzender des Senats ist politisch wenig relevant; dafür kann von großer Bedeutung sein, dass er beim Ausfall des Präsidenten umgehend dessen Nachfolger wird.
Der traditionelle Widerpart des Präsidenten im politischen Geschehen der USA ist der Kongress ('Congress'). Er besteht aus zwei Häusern, dem Senat und dem Repräsentantenhaus. In den Senat ('Senate') entsendet jeder Bundesstaat unabhängig von seiner Bevölkerungszahl zwei Vertreter, deren Amtsperiode sechs Jahre dauert. Da alle zwei Jahre ein Drittel der Senatoren neu gewählt wird, überlappen sich die Amtszeiten. Die Anzahl der nach dem Mehrheitsprinzip ebenfalls auf Bundesstaatsebene gewählten Abgeordneten des Repräsentantenhauses ('House of Representatives') ist grundsätzlich abhängig von der durch die Volkszählung ('Census') ermittelten Bevölkerungszahl des jeweiligen Bundesstaates, bleibt jedoch seit 1912 auf insgesamt 435 festgelegt. Abgeordnete werden für zwei Jahre gewählt.
Da es für die Mitglieder der beiden großen politischen Parteien keinen Fraktionszwang gibt, kann auch ein Präsident, dessen Partei im Kongress in der Minderheit ist, die notwendige Mehrheit für ein von ihm erstrebtes Vorhaben finden. Viel häufiger jedoch ist der Zustand des sogenannten 'gridlock' (politische Lähmung), wenn weder Präsident noch gegnerische Partei im politischen Streit nachgeben wollen, so dass die Regierungsarbeit blockiert ist. Zum System der 'checks and balances' gehört auch, dass beide Häuser in der Gesetzgebung zusammenarbeiten müssen und dass der Präsident die Gesetze unterzeichnen oder sein Veto einlegen kann. Dieses Veto kann wiederum mit Zweidrittelmehrheit beider Häuser überstimmt werden. Obwohl der Präsident als Oberbefehlshaber der Streitkräfte fungiert, kann nur der Kongress den Krieg erklären. Der Kongress ist auch für die Vergabe von Haushaltsmitteln zuständig und kann das Verfahren zur Amtsaufhebung ('impeachment') von Mitgliedern sowohl der Exekutive bis hin zum Präsidenten selbst auch der Judikative einleiten. Der Senat hat vor allem in Fragen der Außenpolitik eine Schlüsselstellung, denn nur mit seiner Zustimmung - und hierzu ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich - darf der Präsident internationale Verträge ('treaties') abschließen; er kann jedoch selbständig handeln, sofern es nur um Abkommen oder Übereinkünfte ('agreements') geht.
Neben dem gesetzgebenden Kongress und dem Präsidenten als Haupt der Exekutive ist das Justizwesen ('judiciary') der dritte Träger des amerikanischen Staatsgefüges. Aufbau und Funktionsweise der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterscheiden sich stark von kontinentaleuropäischen Gepflogenheiten. US-amerikanische Rechtswissenschaft leitet sich aus dem englischen gemeinen Recht ('common law') her, einem System unkodifizierter Regeln, das sich aus gerichtlichen Entscheidungen zu konkreten Präzedenzfällen entwickelt hat. Dabei bekommt die richterliche Auslegung Vorrang vor der eigentlichen Gesetzgebung und steht somit im völligen Gegensatz zum bürgerlichen Recht, das der Interpretation und Untersuchung von Gesetzestexten durch Rechtswissenschaftlern größere Bedeutung beimisst. Ein Strafgesetzbuch oder Zivilgesetzbuch wird man daher in den USA vergeblich suchen.
Die höchste Justizinstanz ist der 'United States Supreme Court' (Oberster Bundesgerichtshof) mit Sitz in Washington, DC, zu dessen wichtigsten Aufgaben die verfassungsrechtliche Normenkontrolle gehört. Neue Richter am Supreme Court werden vom Präsidenten auf Lebenszeiten ernannt, wenn einer der neun bisherigen Richter ausscheidet; er braucht dazu allerdings die Zustimmung des Senats, doch kann ein Präsident damit weit über seine Amtszeit hinaus Grundüberzeugungen der von ihm vertretenen Politik festlegen. Vom Supreme Court ergingen, je nach Zusammensetzung, vielfach politisch gestaltete, oft auch Kontroversen auflösende und selbst kontroverse Urteile zur Meinungsfreiheit, zu Rassenfragen und zum Strafrecht, so z.B. die Abschaffung und die Wiedereinführung der Todesstrafe (1972 bzw. 1976) oder 1973 die Freigabe der Abtreibung.
Die föderalistische Grundordnung hat zur Folge, dass zwei Gerichtssysteme - Bundesgerichte und Gerichte der Einzelstaaten - nebeneinander stehen. Im Gegensatz zu den Bundesrichtern, die ernannt werden, werden die Richter in den einzelnen Bundesstaaten gewählt und büßen damit häufig ihre politische Unabhängigkeit ein.
Die föderale Struktur der Vereinigten Staaten erschwert es, die Gegebenheiten in den Bundesstaaten zu verallgemeinern. Verglichen mit den Kompetenzen der deutschen Bundesländer reichen die der amerikanischen Staaten erheblich weiter; bei der Weite des Landes bleibt die Notwendigkeit einer starken lokalen Entscheidungsgewalt unverändert bestehen.
An der Spitze jedes Bundesstaates steht ein Gouverneur ('governor'). Ähnlich wie auf Bundesebene gibt es einen Kongress ('legislature'), bestehend aus Senat und Abgeordnetenhaus. Die Stellung des Gouverneurs ist zwar politisch wichtig, er bleibt jedoch den Beschlüssen des Kongresses seines Staates verpflichtet. Das zeigt sich beispielsweise am Recht des Staatsparlaments, bei der Ernennung von Beamten entscheidend mitzusprechen. Ein Veto des Gouverneurs gegen eine Entschließung des Kongresses kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss aufgehoben werden. Bedeutsam wurde mehrfach die Befugnis des Gouverneurs, bei inneren Unruhen die Staatspolizei durch Nationalgardisten zu verstärken.
Seit dem Sezessionskrieg und der Wahl des Republikaners Abraham Lincolns im Jahr 1860 sind Republikaner und Demokraten die dominanten Parteien in den USA. Zwar gab es auch einige andere Parteien, doch hat keine davon einen Präsidenten gestellt. Die Entwicklung der beiden großen Parteien ist allerdings bemerkenswert. Während sich die Republikaner bei ihrer Gründung entgegen den Demokraten für die Sklavenbefreiung und danach für die Sicherung der Rechte der Schwarzen einsetzten, ist es inzwischen die demokratische Partei, die eher die Interessen von Minderheiten vertritt. Deutlich wird dies an Wahlergebnissen: So wählten bei der Präsidentschaftswahl 1992 nur 11% der schwarzen Wähler den Republikanischer George Bush.
Aus europäischer Sicht bestehen zwischen den zwei großen Parteien vielleicht kaum Unterschiede, doch angesichts der verhältnismäßig heterogenen Wählerschaft und den Bedingungen der Mehrheitswahl ist ein hohes Maß an Flexibilität und Kompromissbereitschaft von den Parteien gefordert. Wenn eine Partei sich zu weit vom Zentrum entfernt, wird ihre Chance, an die Macht zu kommen oder dort zu bleiben, immer geringer. Mit einem Kandidaten wie George McGovern (1972) z.B. wurden die Demokraten als zu liberal gesehen, während sich die Republikaner unter George Bush (1992) zu stark von den religiösen Fundamentalisten beeinflussen ließen, so dass viele Wähler abgeschreckt wurden. Auch wenn Unterschiede zwischen der republikanischen und der demokratischen Partei manchmal schwer auszumachen sind, lässt sich feststellen, dass in der heutigen politischen Landschaft die Republikaner eher konservativ eingestellt sind und vorwiegend Wirtschaftsinteressen repräsentieren. Die Demokraten gelten als reformfreudiger und finden mehr Anklang bei Minderheiten, Frauen und Arbeitnehmern; allerdings vermeiden die Gewerkschaften, sich auf eine Partei festzulegen. Eine der Parteien einer bestimmten Tendenz zuzuordnen, wird auch durch den Umstand erschwert, dass im Kongress, wo kein Fraktionszwang besteht, sich problembedingt immer wieder neue zwischenparteiliche Strömungen und Gruppierungen bilden können.
Die Organisation der amerikanischen Parteien ist wesentlich lockerer als in Europa. Organisierte Parteimitgliedschaften, formelle Aufnahmeverfahren und regelmäßige Beitragspflicht sind ihnen fremd. Um einer Partei anzugehören, muss ein Wähler sich durch Eintrag in eine Wählerliste nur als Demokrat oder Republikaner "erklären". Notwendig machen diese Prozedur nur die Vorwahlen, denn nur die "Mitglieder" der jeweiligen Partei dürfen sich an der Vorwahl innerhalb einer Partei beteiligen. Durch die Teilnahme an der Vorwahl wird man automatisch "Mitglied" dieser Partei.